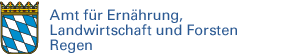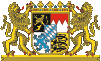Auf Naturverjüngung gesetzt
Waldumbau ohne Schnickschnack
Josef Wurm kniet auf dem Boden seines Waldes in Rehberg und betrachtet zufrieden eine kleine Tanne, die inmitten konkurrierender Vegetation hervorsprießt. Dieses Tannenbäumchen hat gute Chancen auf ein langes Leben im Rehberger Wald. „Hier hat mein Vater vor ungefähr 70 Jahren auf einer Wiese eine reine Fichtenanpflanzung angelegt. Als kleiner Bub bin ich da oft beim Schwammerlsuchen durchgegangen, da waren die Fichten ungefähr mannshoch“, erinnert er sich zurück.
Die Anpflanzung von solchen Reinkulturen war zu damaliger Zeit üblich. Die anspruchslose und schnell wachsende Fichte gilt als „Brotbaum“ und wurde wegen ihrer vielseitigen Verwendbarkeit, zum Beispiel als Bauholz oder für die Papierherstellung geschätzt und ist zudem eine wichtige Einnahmequelle. Doch Fichte kann wegen ihres flachen Wurzelwerks Trockenperioden nicht so gut abfedern. Reinbestände sind anfällig für Borkenkäferbefall oder Schäden durch Stürme wie Kyrill oder Niklas.
Mit Naturverjüngung in die nächste Generation
Daher hat der aufgeschlossene Landwirt schon früh begonnen, seinen Waldbestand und insbesondere auch die Fichtenanpflanzung in einen klimafitten Mischwald umzuwandeln. „Doch das funktioniert nicht, indem man den Wald einfach sich selbst überlässt. Wichtig ist am Anfang, dass man ältere Bäume nach und nach rausschlägt, damit wieder Licht in den Wald kommt. So können die jungen Bäume nachwachsen“, sagt er.
Mit Unterstützung seines zuständigen Försters und Revierleiters Simon Hackl vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Regen legt er dazu vorher fest, welche Bäume als sogenannte Zukunftsbäume erhalten werden sollen. Diesen sprüht er zur besseren Erkennbarkeit einen gelben Ring um den Stamm. Konkurrierende Bäume in unmittelbarer Nähe werden gefällt. Für den Transport der Stämme zur Straße legt er Rückegassen an, damit die gefällten Stämme nicht kreuz und quer durch den Wald gezogen werden müssen. Das schont den Waldboden und die verbleibenden Bäume. In den letzten drei Jahrzehnten ist auf diese Weise unter dem Schirm der ehemaligen Monokultur ein junger, gemischter Bestand mit verschiedenen Höhen entstanden.
„Alles, was man hier sieht, ist auf natürlichem Weg gewachsen, also eine Naturverjüngung“, betont Josef Wurm: „Vor allem unsere Hauptbaumarten Fichten, Tannen, Buchen, Ahorn, aber auch einzelne Eichen, Birken und Ebereschen haben sich durchgesetzt." - “Survival of the Fittest“
Verbiß und Biodiversität im Blick
Die Samen werden von angrenzenden Baumbeständen durch den Wind oder über Tiere wie Vögel oder Eichhörnchen eingetragen. Aber ganz ohne sein Zutun geht es dann doch nicht. Insbesondere junge Tannen werden im Winter gern vom Rehwild angefressen, wenn sie wenig Nahrung finden, vor allem, wenn die Population hoch ist. Daher muss er im Herbst Verbißschutzmaßnahmen durchführen. Für die Biodiversität lässt er gerne Totholzbäume stehen, die nicht vom Borkenkäfer befallen sind, und auch kleinere Äste von gefällten Bäumen lässt er im Wald zurück. Diese bieten Nahrung für Mikroorganismen, Insekten, Vögel und Säugetiere und fördern nach der Zersetzung die Humusbildung.
Förderprogramme für den Klimawandel
Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Daher ist es oberstes Ziel, unsere Wälder in zukunftsfähige Mischbestände umzubauen. Eine Mammutaufgabe für unsere Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer. Unterstützung bekommen sie von den Försterinnen und Förstern der bayerischen Forstverwaltung in Form von kostenfreier Beratung und durch finanzielle Förderung, denn ein gesunder Wald kommt der gesamten Bevölkerung zugute. Er bindet Kohlendioxid, filtert die Luft, verhindert Hochwasser, liefert wertvollen Rohstoff und dient der Erholung. Bayernweit stehen jährlich rund 90 Millionen Euro für alle forstlichen Förderprogramme zur Verfügung. Zum 1. Juli dieses Jahres erfolgt die Abwicklung des Waldförderprogramms WALDFÖPR sogar digital und papierlos.
Aktiver Waldumbau
Beim aktiven Waldumbau führen viele Wege nach Rom. Dies kann über Einsaaten oder Pflanzung von neuen, trockenheitstoleranten Baumarten wie zum Beispiel Douglasie, Lärche, Elsbeere, Vogelkirsche, Feldahorn, Speierling oder Edelkastanie erfolgen. Oder durch die Naturverjüngung, die Josef Wurm praktiziert.
„Holz machen! Keinen Kahlschlag, aber in regelmäßigen Abständen Altbäume entnehmen damit durch Licht wieder neues Leben am Waldboden entstehen kann", so lautet Förster Simon Hackls Credo. Und weiter empfiehlt er: „Breit aufstellen. Nicht alles auf eine Karte- sprich- eine Baumart setzen, sondern einen gesunden Mischwald aus Nadel- und Laubbäumen anstreben."
Auf diese Weise kommen die Försterinnen und Förster und Waldbauern wie Josef Wurm ihrem Ziel immer näher: den Wald für die kommenden Generationen zu erhalten.
Ansprechpartner
Simon Hackl
AELF Regen
Dreisesselstraße 8
94089 Neureichenau
Telefon: 09921 608-3020
Mobil: +49 175 7251637
Fax: +49 9921 608-2258
E-Mail:
poststelle@aelf-rg.bayern.de
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
![]()