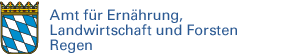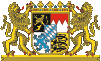Gemeinsam gegen den Borkenkäfer
Forstexperten entwickeln neue Waldschutzstrategie
Am 17. September 2025, trafen sich 20 Forstexpertinnen und Forstexperten aus den Landkreisen Regen und Freyung-Grafenau zum Runden Tisch „Borkenkäfer“ im Hause zur Wildnis.
Eingeladen hatte das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Regen. Mit dabei waren Vertreterinnen und Vertreter der Nationalparkverwaltung, der Forstbetriebe Bodenmais und Neureichenau der Bayerischen Staatsforsten, der Gutsverwaltungen Frauenau und Oberzwieselau, der Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern, der Waldbesitzervereinigungen Freyung-Grafenau, Regen und Viechtach, die Initiative Lindberg, die Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft, sowie das AELF Regen.
Erfahrungsaustausch als feste Institution für den Waldschutz
Im Mittelpunkt des Treffens stand die gemeinsame Erarbeitung einer Waldschutzstrategie mit Fokus auf den Borkenkäfer. „Der Runde Tisch bietet uns die Möglichkeit, Erfahrungen zu teilen und konkrete Strategien zur Bewältigung von Großkalamitäten wie dem Borkenkäferbefall in der Region zu entwickeln“, betonte Christoph Salzmann, Bereichsleiter Forsten am AELF Regen. Ziel sei es, die Wälder widerstandsfähiger zu machen und sich gemeinsam den Herausforderungen des Borkenkäferbefalls zu stellen. Bereits seit 2015 (mit Unterbrechung während Corona) hat sich der Runde Tisch „Borkenkäfer“ als feste Institution etabliert und findet mittlerweile dreimal jährlich im März, Juli und September statt.
Konkrete Maßnahmen für einen widerstandsfähigen Wald
Die gemeinsam erarbeitete Waldschutzstrategie wird bis zum nächsten Runden Tisch vorliegen. Sie umfasst eine Ist-Analyse, ein Leitbild für den Borkenkäfer-Waldschutz und konkrete Handlungsfelder. Dazu zählen – außerhalb des Nationalparks - unter anderem das Absenken von Fichten-Vorräten zur Risikominimierung, die frühzeitige Verjüngung der Waldbestände zur Steigerung der Widerstandskraft, das Aufbrechen von Inselstrukturen, das frühzeitige Erkennen von Borkenkäferbefall sowie die Erhöhung der Schlagkraft bei Kalamitäten. „Mit der neuen Waldschutzstrategie wollen wir gemeinsam die Weichen für einen widerstandsfähigen Wald der Zukunft stellen“, so Christoph Salzmann abschließend. Bis zum nächsten Treffen im März 2026 soll die Strategie als Grundlage für das weitere Vorgehen dienen.
Debarking-Harvester: Moderne Technik im Kampf gegen den Borkenkäfer
Ein priorisiertes Ziel der neuen Strategie ist die Schaffung mobiler Entrindungskapazitäten, insbesondere durch den Einsatz von sogenannten Debarking-Harvestern. Diese Weiterentwicklung eines normalen Harvesters (auch Holzvollernter) können Bäume nicht nur fällen und entasten, sondern gleichzeitig auch die Rinde entfernen. Da sich der Borkenkäfer bevorzugt unter der Rinde einnistet, wird durch das sofortige Entrinden die weitere Ausbreitung des Schädlings wirksam verhindert. Der Einsatz solcher Technik ermöglicht eine schnelle und effiziente Bekämpfung von Borkenkäferkalamitäten. Hier hilft die Nationalparkverwaltung, sie hat bereits viel Erfahrung mit der neuen Technik.
Aktiv Holz machen lohnt sich: Naturverjüngung einleiten und Vorräte senken
Die Forstexperten weisen darauf hin, dass auch im Winter eine saubere Waldwirtschaft entscheidend ist. Unter dem Motto „Sauber durch den Winter“ wird Waldbesitzenden empfohlen, befallene oder gefährdete Bäume konsequent zu entfernen und das Holz aus dem Wald zu schaffen. Gerade jetzt ist es wichtig, übersehene Käferlöcher zu finden und aufzuarbeiten, um dem Borkenkäfer keine Überwinterungsmöglichkeiten zu bieten. Waldbesitzende werden zudem ermutigt, aktiv Frischholz in ihren Beständen zu ernten. Durch die gezielte Entnahme von Fichten wird Platz geschaffen, sodass sich junge Bäume – oft aus natürlicher Aussaat – entwickeln können. Diese sogenannte Naturverjüngung sorgt für einen stabileren, artenreicheren und klimaresilienteren Wald. Gleichzeitig wird durch das Absenken der Fichtenvorräte das Risiko eines massiven Borkenkäferbefalls deutlich reduziert. Wer jetzt handelt und Holz erntet, profitiert doppelt: von gesunden, zukunftsfähigen Wäldern und attraktiven Holzpreisen.
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden